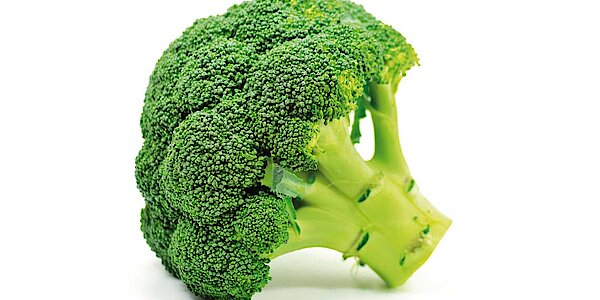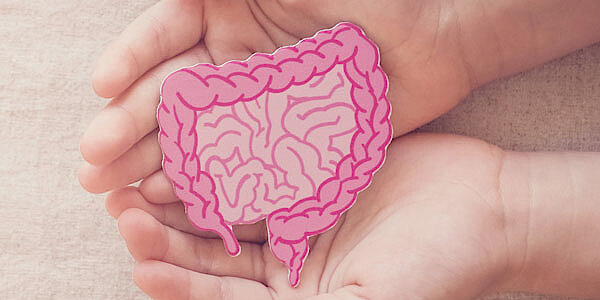Was sind Sekundäre Pflanzenstoffe?
Sekundäre Pflanzenstoffe sind eine vielfältige Gruppe von bioaktiven Substanzen, die ausschließlich von Pflanzen gebildet werden. Im Gegensatz zu primären Pflanzenstoffen wie Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten, die dem Energiestoffwechsel dienen, sind Sekundäre Pflanzenstoffe für das Überleben der Pflanze in ihrer natürlichen Umgebung essenziell. Ihre Anwesenheit wird in der Regel nicht durch Mangelerscheinungen erkannt – dennoch spielen sie eine Schlüsselrolle für die Qualität pflanzlicher Lebensmittel.
Sekundäre Pflanzenstoffe kommen typischerweise in:
- Obst- und Gemüsesorten
- Vollkornprodukten
- Hülsenfrüchten
- Kräutern und Gewürzen
vor und beeinflussen dabei Geschmack, Farbe, Geruch und Haltbarkeit der Produkte.
Funktionen und Bedeutung in Pflanzen
In der Pflanzenwelt übernehmen Sekundäre Pflanzenstoffe komplexe ökologische Aufgaben. Sie bilden eine Art chemisches Kommunikations- und Verteidigungssystem, das die Pflanze vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt.
Typische Funktionen:
- Abwehr von Schädlingen und Mikroorganismen
Viele Pflanzen bilden Bitterstoffe, die für Insekten unattraktiv oder toxisch sind. - UV-Schutz
Farbstoffe wie Flavonoide und Carotinoide absorbieren UV-Strahlung und verhindern Zellschäden. - Anlockung von Bestäubern
Duft- und Farbstoffe erhöhen die Fortpflanzungschancen, indem sie Insekten anziehen.
Sekundäre Pflanzenstoffe sind für den Menschen zwar nicht essenziell, leisten jedoch einen wichtigen Beitrag zur ernährungsphysiologischen Qualität pflanzlicher Lebensmittel. Ihr gesundheitliches Potenzial wird zunehmend erforscht und gewinnt in der Ernährungswissenschaft stetig an Bedeutung. Daher werden sie auch häufig als „Vitamine des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet.
Bekannte Sekundäre Pflanzenstoffe und ihre Wirkungen auf die Pflanzen
In der Praxis lassen sich mehrere Klassen Sekundärer Pflanzenstoffe unterscheiden, von denen viele auch in der Lebensmittelindustrie zunehmend Beachtung finden:
- Polyphenole (z. B. Resveratrol, Flavonoide, Phenolsäuren)
Schützen Pflanzen vor oxidativem Stress und UV-Schäden. - Carotinoide (z. B. Beta-Carotin, Lutein)
Farbgebende Pigmente mit Lichtschutzfunktion. - Glucosinolate
In Kohlgemüse enthalten; bei Zellschädigung werden sie zu Senfölen umgewandelt – ein Schutzmechanismus gegen Fressfeinde. - Saponine
Oberflächenaktive Stoffe mit fungizider und insektizider Wirkung. - Phytoöstrogene
Kommen u. a. in Sojabohnen vor; steuern pflanzeneigene Hormonprozesse und beeinflussen die Interaktion mit Mikroorganismen.
Beispiel: Resveratrol und das französische Paradoxon
Resveratrol ist ein Sekundärer Pflanzenstoff, der insbesondere in roten Weintrauben enthalten ist. In der Pflanze übernimmt er eine schützende Funktion gegen Umweltstress wie UV-Strahlung, Schädlinge oder Pilzbefall.
Resveratrol kommt auch in Rotwein vor – eine Verbindung, die im Zusammenhang mit dem sogenannten französischen Paradoxon diskutiert wird: In Frankreich ist trotz einer vergleichsweise fettreichen Ernährung die Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen auffallend gering. Ein möglicher Erklärungsansatz ist der regelmäßige, aber moderate Konsum von Rotwein, der Resveratrol in bioaktiver Form enthält. Auch der japanische Staudenknöterich gilt als bedeutende pflanzliche Quelle dieses wertvollen Sekundären Pflanzenstoffs.
Forschung und aktuelle Erkenntnisse im Bereich der Sekundären Pflanzenstoffe
Sekundäre Pflanzenstoffe stehen zunehmend im Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen – nicht nur in der Pflanzenforschung, sondern auch im Hinblick auf ihre Rolle in der Ernährung des Menschen. Während sie Pflanzen beispielsweise vor Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung oder Schädlingen schützen, wird aktuell intensiv erforscht, wie sie sich auf molekularer Ebene verhalten – etwa im Zusammenspiel mit zellulären Prozessen.
Dabei interessieren sich Forschende insbesondere für ihre natürlichen antioxidativen Eigenschaften und ihre mögliche Interaktion mit zellulären Strukturen, einschließlich der DNA. Erste Studien liefern spannende Ansätze, die derzeit in internationalen Forschungsprojekten weiter untersucht werden.
Auch im Bereich funktioneller Lebensmittel rücken Sekundäre Pflanzenstoffe stärker in den Mittelpunkt – beispielsweise bei der Entwicklung pflanzenbasierter Produkte mit optimierter Zusammensetzung. In der Agrarforschung wiederum spielen sie eine Rolle als Indikatoren für Pflanzenqualität und Widerstandsfähigkeit.
Zwar dürfen laut aktueller Rechtslage keine gesundheitsbezogenen Aussagen getroffen werden, doch die wachsende Zahl wissenschaftlicher Studien unterstreicht das zunehmende Interesse an ihrem potenziellen Einfluss im Kontext einer ausgewogenen Ernährung.
Fazit
Sekundäre Pflanzenstoffe sind weit mehr als bloße Begleitstoffe in unserer Ernährung. Sie erfüllen in Pflanzen lebenswichtige Aufgaben und beeinflussen die Qualität unserer pflanzlichen Lebensmittel maßgeblich. Forschung und Lebensmitteltechnologie erkennen zunehmend ihren Wert – nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für Verbraucherinnen und Verbraucher, die auf natürliche, hochwertige Produkte setzen.
Dr. med. Dipl.-Ing. Georg Wolz
Facharzt für Allgemeinmedizin und Ernährungsmedizin und Dipl.-Ing. für Biotechnologie
Dr. med. Dipl. Ing. Georg Wolz studierte an den Technischen Universitäten Berlin und München Biotechnologie und Ernährungstechnologie. Anschließend begann er ein Medizinstudium an der Johan-Gutenberg-Universität Mainz, das er mit einer Promotion abschloss. Danach folgte die Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin sowie zahlreiche Weiterbildungen – u.a. zum Ernährungsmediziner der Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM). Nach Tätigkeiten in verschiedenen Krankenhäusern arbeitete Wolz als niedergelassener Arzt mit eigener Praxis im Raum Bingen.
Zurück zur Übersicht
Qualität heißt für uns die sorgfältige Auswahl der Rohstoffe, kontinuierliche Rückstandsanalysen, zertifizierter Herstellungsprozess und die Überprüfung der Wirksamkeit unserer Präparate durch unabhängige Forschungseinrichtungen.